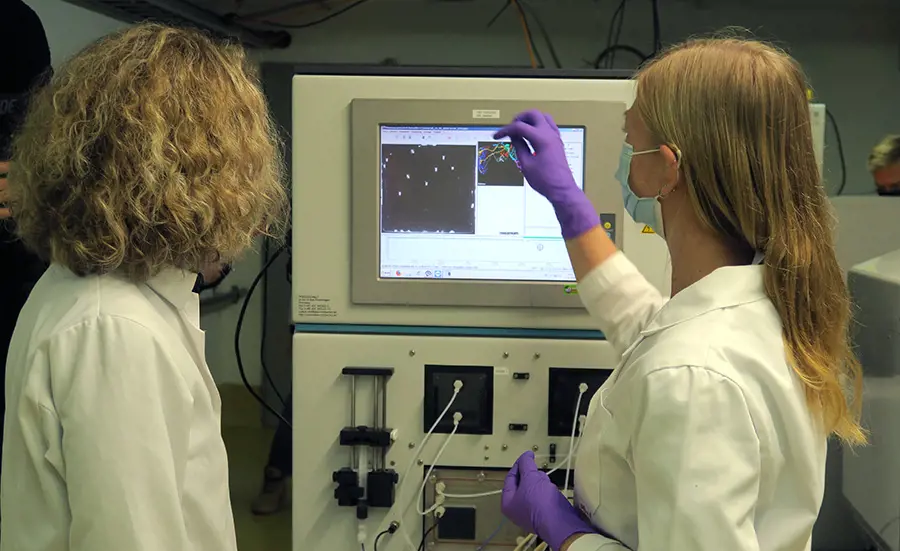
Früherkennung für Abwasserreinigungsanlagen
Eine Kombination aus biologischem und chemischem Onlinemonitoring wurde als Frühwarnsystem auf einer kommunalen Abwasserreinigungsanlage getestet. Das System ist in der Lage, Spitzenbelastungen durch Mikroverunreinigungen im gereinigten Abwasser zu erfassen und toxische Schadstoffe in Echtzeit zu erkennen. So kann es zur Verbesserung im Abwassermanagement beitragen.
Die Qualität von Oberflächengewässern steht unter vielfältigem Druck, da wir immer mehr Chemikalien verwenden, die auf unterschiedlichen Wegen in Gewässer gelangen. Umso wichtiger ist die Rolle der Abwasserreinigungsanlagen (ARA), in denen die meisten Abwasserströme vor der Einleitung in die Gewässer aufbereitet werden. Durch den Ausbau vieler ARA mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe gelang eine entscheidende Verbesserung bei der Entfernung von Mikroverunreinigungen. Dennoch muss die Qualität des Abwassers stets überprüft werden, um beispielsweise Störfälle bei Industrieeinleitungen zu erkennen und schnellstmöglich reagieren zu können.
Traditionelle Überwachungsmethoden mit Stich- oder Sammelproben stossen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, kurzfristige Konzentrationsspitzen zu erfassen oder zeitnah auf potenziell kritische Substanzen zu reagieren. Besonders bei industriellen Einleitungen kann sich die Zusammensetzung des Abwassers sehr kurzfristig ändern. Durch Anpassungen in den Produkten oder Prozessen entstehen immer neue Abfall- und Nebenprodukte. Ausserdem können extreme Wetterereignisse, wie zum Beispiel starke Regenfälle, die Kanalisation und die ARA überlasten. Auch Temperaturschwankungen beeinflussen die Reinigungsleistung. All dies kann dazu führen, dass die Qualität des gereinigten Abwassers nicht mehr gewährleistet ist.
Eine mögliche Lösung bieten biologische Frühwarnsysteme – man spricht hier auch von Online-Biomonitoring. Diese Systeme setzen Wasserorganismen ein, um die biologische Wirkung von Substanzen im Abwasser kontinuierlich und in Echtzeit zu überwachen. Werden solche Methoden mit einer kontinuierlichen chemischen Analyse gekoppelt, so ermöglicht dies eine ganzheitliche Bewertung der Wasserqualität und der potenziellen toxischen Effekte von Mikroverunreinigungen.
Batterie aus biologischen Frühwarnsystemen
In biologischen Frühwarnsystemen reagieren Testorganismen auf Belastungen im untersuchten Wasser mit messbaren Veränderungen in einem Stoffwechselprozess oder dem Verhalten. Überschreitet diese Änderung, die laufend überwacht wird, einen Schwellenwert, wird ein Alarm ausgelöst. Als Sensoren werden verschiedene Organismen wie Bakterien, Algen, Kleinkrebse oder Fische eingesetzt, die stellvertretend für die Organismen im Ökosystem stehen. Als Messparameter eignen sich beispielsweise die Photosyntheseaktivität von Algen oder das Schwimmverhalten und die Atmung von Krebstieren und Fischen, die durch Schadstoffe beeinflusst werden können.
Da alle Organismen unterschiedlich auf Mikroverunreinigungen reagieren, gibt es keinen einzelnen Testorganismus, der alle Schadstoffe zuverlässig detektiert. Ideal ist daher eine Batterie aus verschiedenen Systemen, die sich gegenseitig ergänzen. Das Forschungsteam um Ali Kizgin, der dieses Thema in seiner Doktorarbeit untersucht hat, wählte drei Testsysteme aus, die verschiedene Ernährungsebenen abdecken: Zum einen eine einzellige Grünalge, bei der die Photosyntheseaktivität durch die kontinuierliche Messung der Fluoreszenz betrachtet wird. Zum anderen zwei Süsswasserkrebse, nämlich Wasserflöhe und Bachflohkrebse, bei denen das Schwimmverhalten und die Aktivität durch Kameras und Bewegungssensoren überwacht werden. Am Projekt war neben dem Oekotoxzentrum auch die Fachhochschule Nordwestschweiz beteiligt, ausserdem die Abteilungen Umweltchemie und Verfahrenstechnik der Eawag.
Kombination mit chemischer Online-Analytik
«Wenn man die Biomonitore mit einer hochauflösenden chemischen Analytik kombiniert, so wird es möglich, biologische Alarme zu bestätigen und herauszufinden, welche Substanz für die gemessene Reaktion verantwortlich war», erklärt Ali Kizgin. «Wir waren in einer idealen Situation, da die Eawag gerade das MS2field entwickelt hatte – eine der ersten mobilen Messplattformen, die es erlaubt, Mikroverunreinigungen in umweltrelevanten Konzentrationen im Feld kontinuierlich und zeitlich hochaufgelöst zu messen. Das System arbeitet mit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gekoppelt mit hochauflösender Massenspektrometrie (LC-HRMS/MS) und kann sowohl bekannte als auch unbekannte Verunreinigungen nachweisen».
Es ist jedoch nicht einfach, das Auftreten chemischer Stoffe mit Verhaltensreaktionen zu verknüpfen, da auch andere Umweltfaktoren zu falsch positiven Alarmen führen können. Daher wurden parallel dazu im Abwasser physikalisch-chemische Parameter wie Nitrit, Nitrat und Ammoniak sowie abiotische Faktoren wie Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit überwacht. Die Kombination aus biologischen und chemischen Frühwarnsystemen wurde über fünf Wochen auf einer kommunalen Klaranlage im Kanton St. Gallen, die Abwasser von fast 40’000 Einwohnern reinigt, einem Härtetest unterzogen. Kommunale Kläranlagen sind eine wichtige Quelle von Mikroverunreinigungen aus häuslichen, industriellen und landwirtschaftlichen Quellen. Der Eintrag dieser Schadstoffe kann, je nach Quelle, sehr dynamisch sein, was die Überwachung von Konzentrationsschwankungen mit herkömmlichen Kontrollen erschwert.
Toxische Ereignisse werden überprüft
«Im Versuchsverlauf haben uns die biologischen Frühwarnsysteme tatsächlich mehrmals einen Alarm angegeben», berichtet Ali Kizgin. Die Systeme mit den Wasserflöhen und den Bachflohkrebsen reagierten dabei empfindlicher als das System mit Grünalgen. Bei den Algen wurden keine signifikanten Abweichungen festgestellt, was bedeutet, dass keine Toxizität durch Herbizide vorlag – diejenige Stoffgruppe, auf die dieser Test hautsächlich reagiert. «Das hat uns nicht überrascht», erklärt Ali Kizgin. «Wir haben den Versuch im Winter durchgeführt, und in dieser Zeit werden in der Landwirtschaft und im häuslichen Umfeld kaum Herbizide eingesetzt.»
«Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, haben wir beurteilt, ob die nachgewiesenen Mikroverunreinigungen in Konzentrationen vorlagen, die hoch genug waren, um toxisch zu wirken», sagt Kizgin. «War dies der Fall, haben wir zusätzliche Experimente im Labor durchgeführt, um zu überprüfen, ob eine bestimmte Chemikalie für die biologische Reaktion verantwortlich war».
Bachflohkrebse am empfindlichsten
Im System mit den Bachflohkrebsen wurden während der Versuchsdauer gleich zwei signifikante Alarme ausgelöst. Beim ersten Alarm waren die Tiere nach einem starken Regen plötzlich deutlich aktiver als zuvor. Das chemische Monitoring konnte aber keine relevanten toxischen Substanzen nachweisen. Da die Wassertemperatur durch das Regenereignis gleichzeitig um zwei Grad von 18,5 °C auf 16,5 °C sank, beeinflusste dies wahrscheinlich das Verhalten der Flohkrebse.
Beim zweiten Alarm konnte mit Hilfe des MS2field das Insektizid Carbofuran nachgewiesen werden, ein in der Schweiz verbotenes Pestizid. Es wurde in einer Konzentration von 1,4 µg/L gemessen, einem Wert, der nahe an der Schwelle liegt, bei der der Stoff für 50 % der wirbellosen Wassertiere toxisch wirkt. Weitere Laborversuche bestätigten, dass Carbofuran mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für den beobachteten Alarm war. „Woher das Insektizid stammt, konnten wir nicht nachvollziehen“, sagt Ali Kizgin. „Wir gehen davon aus, dass es unsachgemäss entsorgt wurde.“
Ein wertvoller Ansatz für das Abwassermanagement
Die Studie zeigt, dass die Kombination von biologischem Onlinemonitoring mit hochauflösender chemischer Überwachung ein wertvoller Ansatz ist, um Spitzenbelastungen durch Mikroverunreinigungen in Kläranlagen zu erkennen. Sie ermöglicht die Erkennung von toxischen Schadstoffen in Echtzeit und trägt so zur Verbesserung des Abwassermanagements bei. «Nachdem wir die Methode erfolgreich im kommunalen Abwasser getestet haben, ist sie nun bereit für den Einsatz auf einer industriellen Abwasserreinigungsanlage», sagt Ali Kizgin. «Damit lassen sich auch Schadstoffe identifizieren, die in komplexen Industrieabwässern vorkommen und mit Standardüberwachungsmethoden nicht erfasst werden können.»
Publikation
Kizgin, A., Schmidt, D., Bosshard, J., Singer, H., Hollender, J., Morgenroth, E., Kienle, C., Langer, M. (2024). Integrating biological early warning systems with high-resolution online chemical monitoring in wastewater treatment plants. Environmental Science and Technology, 58(52), 23148-23159. doi.org/10.1021/acs.est.4c07316
